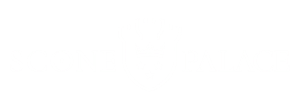William Atkinsons Interpretation der gotischen Ästhetik ist am deutlichsten in der Bibliothek und ihren Einrichtungsgegenständen zu erkennen. Sein Design spiegelt sich in den Türen und Türrahmen sowie den verglasten Bücherschränken wider, die alle aus Eichenholz vom Anwesen geschnitzt wurden. Auch der Kamin und der passende Partnerschreibtisch sind im gotischen Stil gehalten. Der mit Goldbronze und Elfenbein verzierte Säulenschreibtisch aus der Regency Periode wird George Bullock (circa 1777-1818) zugeschrieben. Man kann sich gut vorstellen, wie der 3. Earl of Mansfield an seinem Schreibtisch sitzt, Landschaftsbücher über die gesamte lederbesetzte Oberfläche des Tisches verstreut, während er Pläne für das Anwesen machte. Seine Besucher wurden möglicherweise gebeten, auf dem Sessel aus vergoldetem Holz im Stil George II. (von circa 1740) Platz zu nehmen. Die Rückseite des Sessels wurde im Stil von Thomas Chippendale gefertigt. Sie ist mit einem Stoffpaneel aus kunstvoller Petit-Point-Stickerei aus dem 18. Jahrhundert bezogen, welches mit Gros-Point-Stickerei (Kreuzstich) aus dem 19. Jahrhundert umrandet ist.
Auf dem Schreibtisch befindet sich eine der englischen Uhren des Palastes. Diese schlagende Tischuhr im Stil George III. besitzt drei Zifferblätter (frontal und seitlich) und ist aus Schildplatt und vergoldetem Metall gefertigt. Sie wurde von Charles Edward Viner hergestellt und mit Viner, Sackville St. London signiert. Das im mittleren 19. Jahrhundert gefertigte Stück läutet jede Viertelstunde mit acht Glocken und kündigt jede Stunde mit einem Gong an.
Am anderen Ende des Schreibtischs, in Richtung des Zimmers des Botschafters, steht ein Bureau Plat (französischer Schreibtisch) aus Königs- und Tulpenholz mit vergoldeten Bronzebeschlägen im Stil Ludwig XV. Können Sie die Murray-Sterne auf den seitlichen Zierfriesen erkennen? Auf dem Tisch befindet sich ein gläserner Schaukasten mit einem Rahmen der mit 22-karätigen weißen Blattgold und Gesso dekoriert ist, in dem der französische Paradedegen von David Murray, dem 7. Viscount Stormont (Vizegraf) und späteren 2. Earl of Mansfield, ausgestellt ist. Es handelt sich um einen französischen Galadegen aus dem 18. Jahrhundert, gemeinhin auch als Hofdegen bezeichnet, der dem 2. Earl gehörte, als dieser britischer Botschafter in Paris war. Diese Degen entwickelten sich aus dem Rapier (auch Rappir), waren jedoch leichter und edler. Die oft elegant verzierten Schwerter waren perfekt zum Duellieren und Fechten geeignet. Sie waren auf Balance und Wendigkeit ausgelegt und wurden im 18. Jahrhundert zur allgegenwärtigen Waffe der Gentlemen. Es war unwahrscheinlich, dass ein Gast oder Besucher im Schloss von Versailles empfangen wurde, wenn er nicht einen entsprechend dekorativen Hofdegen trug. Der vorliegende Degen wurde ca. 1770 in Paris hergestellt. Er hat eine dreieckige vergoldete Stahlklinge, was für die damalige Zeit typisch war. Griff, Knauf und Scheide sind mit Silber, Gold, Holz, Stoff, Fischhaut und Pergament verziert.
Über dem Kamin hängt ein Porträt von William Murray, dem 1. Earl of Mansfield (1705 - 1793), gemalt von David Martin. Dieses Ganzkörperportrait, das 1776 für die Bibliothek von Kenwood House gemalt wurde, zeigt den 1. Earl in seinen Gewändern als Lord Chief Justice von England (dt. Lordoberrichter). In der linken oberen Ecke des Gemäldes sehen Sie eine Marmorstatue von Homer. Diese Büste des antiken griechischen Autors wurde vom italienischen Bildhauer Lorenzo Bernini (1598 - 1680) geschaffen und dem 1. Earl von seinem guten Freund, dem englischen Dichter Alexander Pope, geschenkt.
Die Originalstatue befindet sich auf einem marmorierten grauen und siennafarbenen Marmorsockel unterhalb des Bildes im Raum. Auf der anderen Seite des Kamins befindet sich eine Marmorbüste des Hon. William Murray, dem späteren 1. Earl of Mansfield, von Jon Michael Rysbrack (1694-1770) aus dem Jahr 1743. Auf dem Boden, neben dem Kamin, steht eine bezaubernde Bronzeskulptur von Maud, einem der Pekinesen-Hunde des 8. Earl of Mansfield mit der folgenden Inschrift ‚Elizabeth Anne 1977’.
Die Bücherschränke, die den Raum dominieren, würdigen die architektonischen Merkmale des Palastes in Form geschnitzter Zinnen, die über die Länge jeder verglasten Einheit laufen. In den Regalen werden schon lange keine Bücher mehr aufbewahrt, sondern sie stellen die umfangreiche Sammlung britischer und europäischer Porzellane der Familie zur Schau, darunter Stücke aus Sèvres, Meissen, Ludwigsburg, Chelsea, Derby und Worcester. Unter den vielen außergewöhnlichen Stücken gibt es ein Set, das besonders interessant ist. Das apfelgrüne, goldfarbene und weiße Teeservice von Sèvres ist besonders eindrucksvoll. Die außergewöhnliche grüne Farbe entstand, indem den grünen Pigmenten Arsen beigemischt wurde, um die Farbkraft zu erhöhen und der Farbe mehr Lebendigkeit zu verleihen. Es wird angenommen, dass Ludwig XVI. und der 2. Earl of Mansfield dieses Service gemeinsam entworfen haben, und der König es ihm danach geschenkt hat.
In einem der schmalen Bücherschränke sind drei Stücke aus rosa Porzellan ausgestellt, die besonders selten sind. Sie gehören zur Rose Pompadour Kollektion, die von Sèvres in der Mitte des 18. Jahrhunderts für kurze Zeit hergestellt wurde. Das Service verdankt seinen Namen seiner rosa Grundfarbe, die von Sèvres 1757 zu Ehren von Madame de Pompadour, der Geliebten von König Ludwig XV. und treuen Unterstützerin und Förderin der französischen Manufaktur, kreiert wurde.
Das Pigment wurde mit Hilfe von Cassisus’schem Goldpurpur hergestellt. Es ist eine der fünf Farben, die von Sèvres entwickelt wurden und eng mit dem Ruhm der königlichen Manufaktur verbunden war. Porzellanstücke in dieser Farbe wurden allerdings nur für kurze Zeit hergestellt. Sieben Jahre nachdem die rosa Farbe perfektioniert worden war, starb Madame de Pompadour, und der König war so betrübt über ihren Verlust, dass die Porzellanform entsorgt und die Farbe in die Geschichtsbücher verbannt wurde.
Im Regal an der Westseite befinden sich drei Teller mit botanischen Mustern aus der Chelsea Porzellanmanufaktur (von circa 1755/56). Diese Teller sind vielleicht nicht ganz so aufwändig wie andere in der Sammlung; sie sind nichtsdestotrotz bemerkenswert. Chelsea war einer der ersten Hersteller von feinem Porzellan in England, als die Manufaktur 1743-45 gegründet wurde. Diese drei Stücke stammen aus der Zeit des Roten Ankers (1752-1756) und sind mit kräftiger Botanik verziert. Die Chelsea-Fabrik lag in der Nähe des Chelsea Physic Garden in London, welcher wohl das Design beeinflusst hat. Diese frühen innovativen Stücke setzten den Standard für Porzellan in Großbritannien und hinterließen ein Design-Erbe, das bis heute einflussreich ist.
Im Regal an der Nordseite befindet sich das Stormont Service. Dieses Nachtischservice von Sèvres stammt aus dem Jahr 1773 und hat verschiedene Monogramme seiner Maler, darunter die von Lécot Boulanger und Vincent Taillandier. Das Porzellanservice ist mit vergoldeten, eisenroten und grünen Blumen und Blättern verziert. Dieses umfangreiche Set wurde von Lord Stormont gekauft, als er 1773 Botschafter in Paris war.
Im Regal an der Ostwand befindet sich schließlich das Meissener Tee- und Kaffeeservice. Es ist dekoriert in monochromem Grün und zeigt Watteau-Figuren (nach dem französischen Maler Jean-Antoine Watteau), welche von Landschaftsverzierungen und einer filigranen Goldkante umgeben sind. Das Porzellanservice stammt aus dem Jahr 1750 und ist mit den blauen gekreuzten Schwertern gekennzeichnet, die Meissen 1722 eingeführt hat.
Beim Verlassen der Bibliothek werfen Sie bitte einen Blick in die beiden Turmzimmer, die sich jeweils seitlich der Fenster befinden. Diese kleinen Enklaven werden als Französischer und Englischer Raum bezeichnet, da einer französische Literatur und der andere englische Literatur beherbergt. Sie wurden als Lesezimmer konzipiert und jeder Raum hat einen Kamin und bietet spektakuläre Ausblicke auf die Parklandschaften und den Fluss Tay.